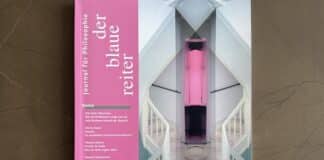Die Zukunft eines Landes zeigt sich darin, wie seine Kinder lernen. Der jüngste Bildungsbericht Deutschlands (2024) hat ein ernüchterndes Zahlenbild gezeichnet: Sinkende Leistungen in den bestimmten Fächern, verlorene Jahre, Lernrückstände…
Laut Bericht erreichen nur 40–60 % der Schüler (9-Klässler) in den Fächern Mathematik, Biologie, Physik und Chemie die „regelmäßigen Lernstandards“. Der Rest zeigt deutliche Leistungseinbrüche. Doch wer etwas genauer hinschaut, erkennt in diesen Zahlen nicht nur die Kinder, sondern das müde Gesicht einer ganzen Gesellschaft.
Diese Schüler waren in der fünften Klasse, als die Pandemie begann. Sie wuchsen vor Bildschirmen auf, in stillen Wohnungen, mit abgebrochenen Beziehungen. Deutschland reagierte – wie so oft – spät. Manche hatten vielleicht keinen Computer oder kein Tablet zu Hause, doch das galt zunächst als Problem der Familien.
In diesen Tagen verloren viele mehr als nur den Anschluss an Mathematikformeln oder physikalische Gesetze – sie verloren das Vertrauen ins Lernen selbst. Im digitalen Unterricht machten sowohl Schüler als auch Lehrer Erfahrungen, die sie zuvor nie erlebt hatten.
Alle waren sich einig: Zwei Jahre lang fehlte den Schülern in vielen Bereichen der Inhaltsstoff. Diese Forschung bestätigt das nun. Aber das eigentliche Problem ist nicht nur dieser Rückstand.
Die deutsche Politik und die zuständigen Institutionen taten sich schwer, rechtzeitig die richtigen Schritte einzuleiten. Denn durch die Digitalisierung fällt es immer schwerer, mit dem schnellen Tempo des Lebens mitzuhalten. Statt präventiv und mutig zu handeln, folgte man dem alten Muster: erst reagieren, wenn das Problem bereits da ist.
Während all dies geschieht, wird die Digitalisierung noch immer als eine einfache Frage eines Bildschirms wahrgenommen, der unser Leben erleichtert. Doch wie Untersuchungen zeigen, handelt es sich dabei um eine Entwicklung, die einen tiefgreifenden Wandel im Denken mit sich bringt. Tatsächlich erlebt der menschliche Geist zum ersten Mal eine so direkte und intensive Begegnung mit dem Bildschirm, also mit dem Internet. Dieses bietet unendlich viele Informationen und Inhalte, und sein Nutzen ist unbestreitbar. Aber um mit den negativen Seiten umgehen zu können, muss unbedingt eine Medienresilienz entwickelt werden. Die Bindung vieler Kinder an das Smartphone ist inzwischen stärker als die zu ihren Eltern.
Der Bildschirm leuchtet, Geist und Sprache erlöschen
Kinder glauben heutzutage, sie „wüssten“ bereits alles. Doch sie übersehen, dass nicht jedes Wissen wie ein fertiger Happen einfach verschlungen werden kann; sie begreifen das nicht. Mit einem Klick finden sie Antworten, mit einem Wischen gelangen sie sofort zu neuen Informationen. Aber sie denken nicht nach, sie fragen nicht, sie hinterfragen nicht.
Vielleicht weil der Zugang so leicht geworden ist, hat das Wissen selbst an Wert verloren. Doch zwischen Wissen und Verstehen besteht immer noch eine tiefe Kluft. Genau in diese Kluft stürzen nach und nach viele Kinder und Jugendliche von heute hinab.
Sie lesen nicht mehr. Ein etwas längerer Text überfordert ihre Geduld. Schon ein etwas längerer Text strapaziert ihre Geduld, von einem Roman oder einer Erzählung ganz zu schweigen …
Die sozialen Medien haben ihre Aufmerksamkeitsspanne auf wenige Sekunden programmiert. Dabei erfordert das Denken ein wenig Mühe, und das Lesen braucht Stille. Vielleicht genießen sie deshalb weder das Denken noch die Ruhe des Lesens. Doch die Stille des Bildschirms; die mögen sie am meisten. Stundenlang und mit großer Lust können sie auf ihre Handybildschirme starren. Die heutigen Generationen leben, ohne zu ahnen, dass moderne digitale Spielzeuge und Medien der Seele auf lange Sicht keine Tiefe verleihen werden.
Hoffentlich erkennt man das, bevor es zu spät ist: Digitale Geräte und Spiele sollten nur begrenzt und kontrolliert eine Rolle im Leben der Kinder spielen. Denn sie fördern in erster Linie das visuelle System, nicht aber Sprache, Denken, Fühlen und Spüren.
Berichte zeigen, dass der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund steigt. Doch der Leistungsabfall betrifft alle. Das beweist: Es geht weniger darum, wer wir sind, sondern wie wir leben.
Übrigens: Beim deutschen Vorlesewettbewerb mit rund 550 000 Teilnehmer gewann die 12-jährige Ayla Uluçam aus Berlin den ersten Preis. Doch viele Kinder mit Migrationshintergrund haben nicht ihr Glück.
Ein Kind, das in einem sozialen Umfeld aufwächst, in dem es keine Bücher gibt, in der keine Diskussionen stattfinden und in der die Neugier nicht gefördert wird, ist – ganz gleich in welchem Land – zur gleichen Stille verurteilt. Was kann man schon von einem Kind erwarten, das seine Eltern nie auch nur einmal in einem Buch blättern gesehen hat!
An einer Schule wurde ein Lesetest mit 150 Fünftklässlern durchgeführt: Nur 34 % konnten flüssig lesen, ein Teil konnte gar nicht lesen, andere nur buchstabierend. Etwa 15–20 % schreiben so schlecht, dass ihre Texte kaum lesbar sind. Kaum zu glauben, dass in einem hochentwickelten Land wie Deutschland Kindern das Lesen und Schreiben in Grundschulen so schwer vermittelt werden kann. Wenn auch die Eltern nicht die nötige Verantwortung übernehmen, ist dieses Ergebnis unvermeidlich.
Manche Kinder verlieren sich völlig in der digitalen Welt, andere finden gar keinen Zugang dazu, und in beiden Fällen ist der Verlierer das Kind. Der Weg, dies zu verhindern, besteht darin, die soziopsychologische Situation des Kindes zu verstehen und sie zusammen mit der digitalen Welt in ein Gleichgewicht zu bringen. Natürlich ist das nicht einfach.
Trotz allem bin ich nicht ganz hoffnungslos. Denn in jeder Zeit gibt es einen Lehrer, die etwas mehr Geduld zeigt, einen Schüler, der seiner Neugier folgt, eine Familie, die ein Gespräch über ein Buch beginnt. Bildung entsteht genau in diesen kleinen Momenten und Räumen neu.
Denn in jeder Zeit gibt es – trotz allem – einige Lehrer, die mit Hingabe unterrichten, einige Schüler, die großen Neugier zum Lernen zeigen, und einige Familien, die ihren Kindern eine angenehme Atmosphäre der Bücher genießen lassen.
Zudem möchte ich auch an die hoffnungsvollen Reaktionen der Politik auf den Bildungsbericht erinnern: Sie reagierte mit Tatendrang statt Resignation. Nach dem ersten Schock forderten die Kultusminister konkrete Maßnahmen: mehr Präsenzunterricht, bessere Lehrerbildung, höhere Unterrichtsqualität und gezielte Förderprogramme. Ich hoffe, dass dies von radikalen Maßnahmen begleitet wird, die – zusammen mit kleineren Klassen – die Digitalisierung unter Kontrolle bringen. Man wird bald verstehen, dass die bloße Verbreitung von Tablets keine Lösung ist.
Aber, wenn ein Land das Lernen verlernt, kommt zuerst die Stille, dann das Desinteresse, dann das Nicht-Denken, Nicht-Fragen, Nicht-Diskutieren. Und eines Morgens merken wir, dass unsere Kinder ebenso müde sind wie wir.
Deshalb sollten Schüler ständig neugierig sein, etwas Neues zu lernen. Vielleicht gelingt es uns so zu erlernen, permanent zu lesen, zu hören und schließlich zu verstehen. Denn die Zukunft eines Landes leuchtet nicht im Schein der Bildschirme, sondern in den Augen eines Kindes, das fragt, liest und denkt.